Auf dem Küchentisch stehen frische Blumen. Bartnelken.
Ich denke in den letzten Tagen viel übers Träumen nach. Nicht das in der Nacht (bless the Lord, ruht dieses Thema im Moment ein wenig), sondern das Träumen tagsüber.
Ich lese viel in Foren mit anderen Betroffenen und stolpere immer wieder über dieselben Sätze:
Das Gefühl, sich nichts erträumen zu können. Was will ich überhaupt? Was kann ich? Worin bin ich gut?
Was möchte ich als Nächstes? Was wünsche ich mir?
Ich frage mich wieso, müssten nicht gerade wir besonders viel von einem anderen Leben träumen? Ich habe also nachgelesen.
(aaaaa ich hab wir gesagt, gemerkt? wir traumatisierten personen, puh)
Es liegt keinesfalls daran, dass traumatisierte Personen nicht fantasievoll und talentiert sind, keine Wünsche oder Ideen haben, nicht kreativ, aktiv und passioniert sind.
Sondern daran – wenn in den Jahren, in denen Selbstwertgefühl, Beziehungsmuster und Urvertrauen erlernt werden, Unsicherheit, Stress und Angst dominieren – es später nicht leichtfällt, sich etwas anderes als Durchhalten vorzustellen.
Ich lese in Büchern und Artikeln über Entwicklung und Trauma, dass das Träumen – also eben genau das Sich-Vorstellen einer eigenen Zukunft – etwas ist, das wir früh im Leben lernen.
Wenn ein Kind merkt, dass es Einfluss auf die Welt um sich herum hat, dann entwickelt es mit der Zeit auch Mut und Vertrauen darin, Dinge anzugehen und sich Wünsche zu erlauben.
Wenn stattdessen traumatische Erfahrungen erlebt werden, dann lernt das Kind eher, durchzuhalten, sich anzupassen, still zu sein.
Weil Träume etwas sind, das ein Gefühl von Sicherheit braucht. Und wenn man dieses Gefühl nie richtig kennengelernt hat, dann wirken Träume manchmal eher wie etwas Gefährliches, Unerreichbares.
Ich träume von einem kleinen Haus, Zeit zum lesen, Zimmerpflanzen, vielleicht ein Naturbadeteich, muss aber nicht. Und wenn ich noch etwas ganz grosses wünschen darf, dann Ruhe und Sicherheit.
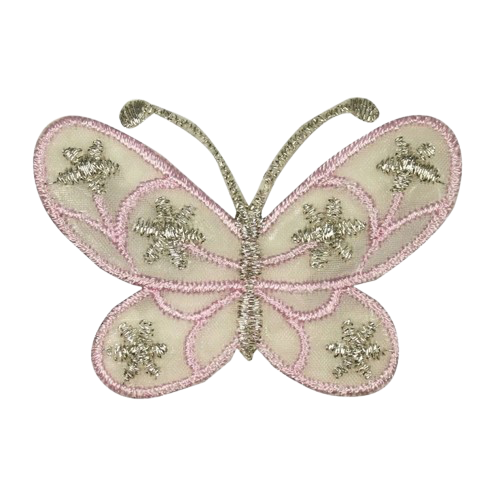
Hinterlasse eine Antwort zu Anonymous Antwort abbrechen