Weil ich nichts mehr muss und alles darf geh ich Abends lang spazieren und Morgens häufig schwimmen.
Ich höre dabei immer wieder die selbe Musik und Atme rhythmisch mit meinen Schritten ein und aus.
Es ist dann oft kühl und leise und ich hoffe jeden Abend, Rehe zu sehen.
Ich las bis gerade eben in „a little life“ und bin wütend, schockiert und aufgewühlt. Das Buch wurde in den sozialen Medien als tränentreibendes Meisterwerk gepriesen und auch wenn ich mich sonst ziere BookTok Empfehlungen zu folgen, konnte ich hier nicht anders.
Hier also meine (zugegeben etwas schnippische) Meinung zum Buch:
Hanya Yanagiharas Roman ist einer der für uns Lesende zur Grenzerfahrung wird. Mit brutaler Schonungslosigkeit erzählt er die Lebensgeschichte von Jude St. Francis, einem jungen Mann, der in seiner Kindheit und Jugend wirklich extremster sexueller, körperlicher und emotionaler Gewalt ausgesetzt war.
Was als wohlfühl Geschichte über Freundschaft beginnt, wird schnell zu einer nahezu unerträglichen Chronik des Schmerzes, die Leser*innen in Judes Spirale aus Selbsthass, Selbstverletzung und Suizidgedanken hinabzieht. Uaaaah! Da kämpft man sich durch 200 Seiten der detailliertesten Charakterbeschreibung die ich seit langem gelesen habe, nur um dann so brutal in den Magen getreten zu werden.
Jude leidet zweifellos an komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, deshalb schreibe ich auch hier darüber.
Im Buch wird es nie so benannt, doch (ich weiss, Fremddiagnose und dann noch von einem Laien ist Blödsinn aber psst es bleibt unter uns ja?) der Fall ist klar.
Mein Problem liegt hier: die Art und Weise, wie Yanagihara dieses Leiden inszeniert, wirft bei mir unweigerlich Fragen auf. Denn der Roman geht weit über eine psychologisch fundierte Darstellung hinaus. Er entwickelt eine Ästhetik des Schmerzes, die in ihrer Intensität und Wiederholung nicht nur erschütternd, sondern zunehmend fragwürdig wird.
Szenen sexueller Gewalt, detaillierte Beschreibungen der Selbstverletzung, immer neue Eskalationen der Misshandlung all das wird mit einer Obsession ausgebreitet, die sich kaum mehr mit reiner Empathie oder Aufklärung rechtfertigen lässt. Es ist fast unerträglich zu lesen, und das nicht weil man so sehr mitfühlt, sondern weil die Autorin den Exzess auf die Spitze treibt.
Jude schneidet sich regelmässig, in ritualisierter Weise. Dabei sind die Schilderungen minutiös. Ich verzichte um den Beitrag für etwas mehr Personen zugänglich und weniger triggernd zu machen auf Zitate.
Aber was mich besonders stört, es offenbart auch Yanagiharas Blick. Immer wieder verweilt der Text bei solchen Szenen, beschreibt Wunden, Blut, Narben, das Geräusch der Rasierklinge, das Gefühl der Erleichterung mit echt teils sadistischer Präzision.
Kritikerinnen wie Andrea Long Chu haben daher vom „Pornography of Trauma“ gesprochen ein Begriff, der hier trifft. „A little life“ macht Trauma nicht nur sichtbar, es fetischisiert es. Es entsteht der Eindruck, dass Jude vor allem deshalb geliebt wird, vom Leser wie von den Figuren , weil er leidet. Seine Unschuld wird aus seiner Vernichtung geboren. Sein einziger Charakter Zug, ist tiefes Leid.
Tatsächlich durchlebt Jude keine Heilung, keine nachhaltige Stabilisierung. Auch in der Zuneigung seiner Freunde bleibt er zutiefst allein. “You don’t understand,” he tells Willem, “I’m not a good person. I’m not even a person” (S. 362). Es ist ein erschütternder Satz und einer, den der Roman selber letztlich bestätigt. Es geschieht kein Wachstum, wir werden mitgenommen auf einer Rutschbahnfahrt in den Abgrund.
Dass eine so gnadenlose Erzählung existiert, hat natürlich eine gewisse Daseinsberechtigung. Sie konfrontiert mit einer Welt, in der Gewalt folgenreich ist.
Aber gleichzeitig verstärkt sie das Narrativ, dass Menschen wie Jude nicht gerettet werden können.
Dass ihre Geschichten nur tragisch enden können.
Dieser Roman schockiert, und das Lesen wird zum stehenbleiben bei einem schrecklichen Autounfall, man muss hinsehen und dabei zuschauen, wie Yanagihara uns über 900 Seiten einen Leidensweg auftischt, der wegen seiner Unerträglichkeit zu Sensation wird.
Die Gefahr dieser Erzählweise liegt darin, dass sie reale Betroffene entmutigt. Denn „A little Life“ zeigt das Leiden, aber nicht das Leben danach. Es gibt keine Therapie, die trägt. Keine Liebe, die heilt. Nur Schmerz, der immer weitergeht bis zur endgültigen Selbstvernichtung.
Das ist keine Repräsentation von kPTBS, das ist wahnsinnig stigmatisierend und trifft mich irgendwie. Ich bin genervt.
Und obwohl sie emotional bewegt, bleibt die Frage offen: Für wen ist dieses Buch geschrieben? Für die, die verstehen, fühlen oder unterhalten werden wollen – oder für in-die-Geisterbahn-steigende Traumafetischisten?
Don’t get me wrong, geschrieben ist das Buch wirklich gut, unterhaltsam, ernst und auf brutale weise sehr berührend und schön war es auch. ICh möchte ihm all das Lob, was es zu recht überall bekommt keineswegs aberkennen. Auch ich sass wie gefesselt da, und las alle 950 Seiten gerne. Aber it doesn’t sit right with me.
Jetzt eine Limonade, zum abkühlen. Grüssli
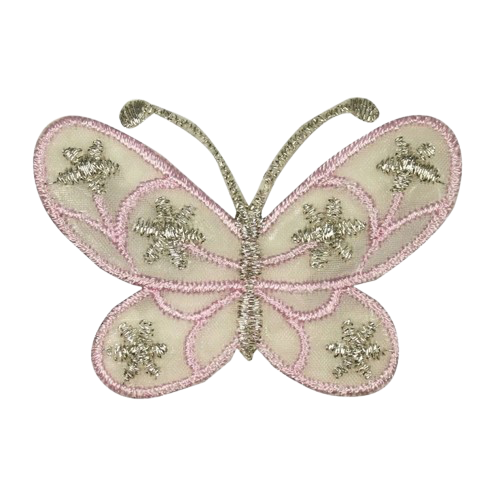
Hinterlasse eine Antwort zu Anonymous Antwort abbrechen